Blindes Vertrauen war gestern: Die DSGVO verpflichtet mit Artikel 28 in Verbindung mit Artikel 32 Organisationen zur regelmäßigen und systematischen Prüfung ihrer Dienstleister. Von der Erstbewertung über die Kontrollpflicht bis hin zu Praxisproblemen – dieser Beitrag zeigt, warum externe Datenschutzprofis für Unternehmen und Kommunen oft die bessere Wahl sind und wie man Dienstleister wirklich prüft, ohne im Hamsterrad zu landen.
Digitale Souveränität ist mehr als ein Schlagwort: In unserem Erfahrungsbericht zeigen wir, wie und warum wir bei a.s.k. Datenschutz von Microsoft 365 auf eine Open-Source-Lösung mit Nextcloud, Zimbra und Collabora gewechselt sind – inklusive Tipps, Herausforderungen und Lessons Learned. Bei der Gelegenheit konnten wir noch zahlreiche weitere externe Lösungen abbauen. Es hat sich gelohnt, in vielerlei Hinsicht.
Das siebte ISB Boot Camp findet am 06.05. und 07.05.2025 in Gunzenhausen statt. Kommunale Informationssicherheitsbeauftragte und deren Stellvertretungen treffen sich zum fachlichen Austausch und zum Netzwerken. Ein breites Spektrum an Themen, dieses Jahr mit Fokus auf den weichen Faktoren und den organisatorischen Bereich, wird im Plenum und in den parallel an zwei Tagen stattfindenden Workshops geboten. Auch der Brückenschlag zwischen Informationssicherheit und Datenschutz steht auf dem Programm. Details und Link zur Anmeldung im Blogbeitrag.
Über die im EU AI Act geforderte KI-Kompetenz ist derzeit viel zu lesen. Was es damit auf sich hat, wen der Aufbau von KI-Kompetenz alles betrifft, wie dies in eine organisationsweite KI-Strategie eingebettet sein sollte und warum es keine "Eine Lösung für Alles" gibt, haben wir Ihnen in unserem Blogbeitrag zusammengetragen. Ein Mosaikstein zum Erwerb und Erhalt von KI-Kompetenz für Mitarbeitende kann unser Webinar "KI clever nutzen - Datenschutz- und Sicherheitsrisiken vermeiden" sein. Dennoch sind weitere Schritte einmalig und wiederkehrend für KI-nutzende Organisationen nicht nur empfohlen, sondern teilweise auch rechtlich gefordert. Lesen Sie mehr im Blogbeitrag.
Schenkt man Medien und "sozialen" Netzwerken Gehör, besteht das Leben nur noch aus schlechten Nachrichten. Realität? Oder Trend zu negativer Berichterstattung für das sog. clickbaiting? Wir wollen mit unseren diesjährigen Weihnachtsgrüßen dem Negativen etwas Positives, zumindest als Anregung entgegensetzen. Allen LeserInnen und ihren Lieben wünschen wir gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2025.
Gerne und oft von Interessensverbänden und der Politik wiederkehrend erzählt, aber dennoch falsch. Nicht der Datenschutzbeauftragte bzw. dessen Pflicht zur Benennung im BDSG und der DSGVO erzeugen den Arbeitsaufwand im Datenschutz. Der Datenschutzbeauftragte wird geschmäht, denn ohne diese Funktion würde ja die ganze Bürokratie und der Aufwand im Datenschutz entfallen. Wer auch nur ein bisschen das Thema verstanden hat, der weiß, dem ist nicht so. Die ganzen rechtlichen Ansprüche im Datenschutz, die es für Organisationen umzusetzen und einzuhalten gilt, entfallen ja nicht, nur weil man den Datenschutzbeauftragten aus dem Gesetz streicht. Aber lesen Sie doch einfach selbst, was es mit der Mär der "Abschaffung der Datenschutzbürokratie" durch Abschaffung des Datenschutzbeauftragten auf sich hat.
Braucht es wirklich drei unterschiedliche Prozesse zur Meldung und Bearbeitung von IT-Störungen, Sicherheitsvorfällen in der Informationssicherheit und Datenschutzverletzungen? Fragt man die Verantwortlichen, heißt es oft eindeutig "Ja klar". Wir werfen einen Blick auf die dazugehörigen Prozesse und legen diese einfach mal neugierig übereinander. Spoiler: Es braucht nur einen Prozess. Mehr im Blogbeitrag.
Welche technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOM) schreibt der Gesetzgeber vor? Und was hat es mit diesem Stand der Technik auf sich? In unserem Blogbeitrag gehen wir auf die Anforderungen des Artikel 32 DSGVO "Sicherheit der Verarbeitung" näher ein. Lesen Sie mehr darüber, was der Gesetzgeber im Hinblick auf zu ergreifende Schutzmaßnahmen von Ihrer Organisation fordert. Warum schreibt der Gesetzgeber für gewöhnlich keine konkreten Schutzmaßnahmen in ein Gesetz, sondern legt lediglich das zu erreichende Ziel fest? Wieso 2FA keine Raketenwissenschaft und Bandsicherung zwar "old school" ist, aber dennoch dem Stand der Technik entspricht.
Das aktuelle EuGH-Urteil (Az. C-604/22 IAB Europe) zum Thema Datenverarbeitung bei personalisierter Werbung hat durchaus Zündstoff. Der EuGH bestätigt die Sicht der Belgischen Datenschutzaufsicht, dass bei Nutzung des Transparency and Consent framework (TCF) und dessen sog. TC-String ein personenbezogenes Datum vorliegt. Dadurch wird die relativ kleine IAB Europe als Betreiber aus Sicht des EuGH zum Gemeinsam Verantwortlichen. Die IAB wiegelt derzeit noch ab. Doch die Konsequenzen können weitreichend (und teuer) sein. Mehr dazu und wieso der Datenschutz nicht an den unleidigen Cookie-Bannern schuld ist im Blogbeitrag.
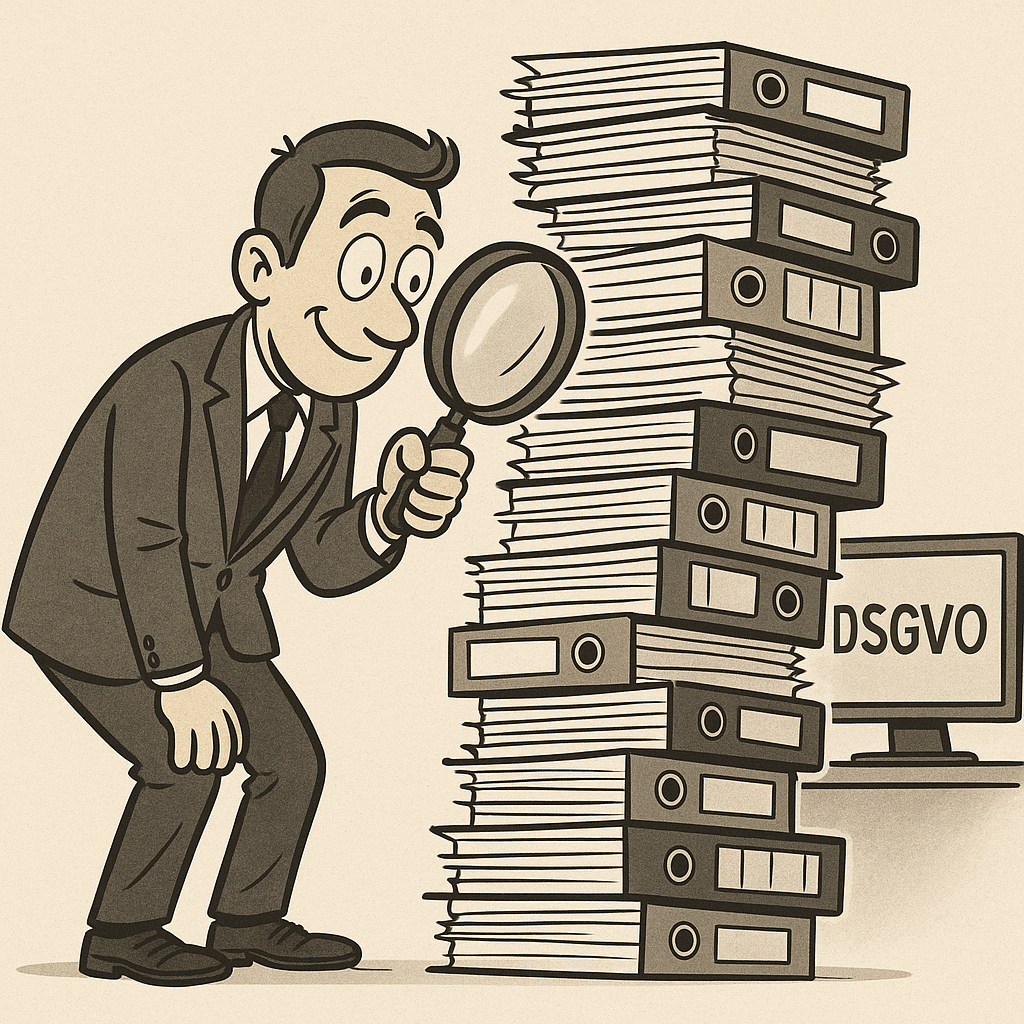


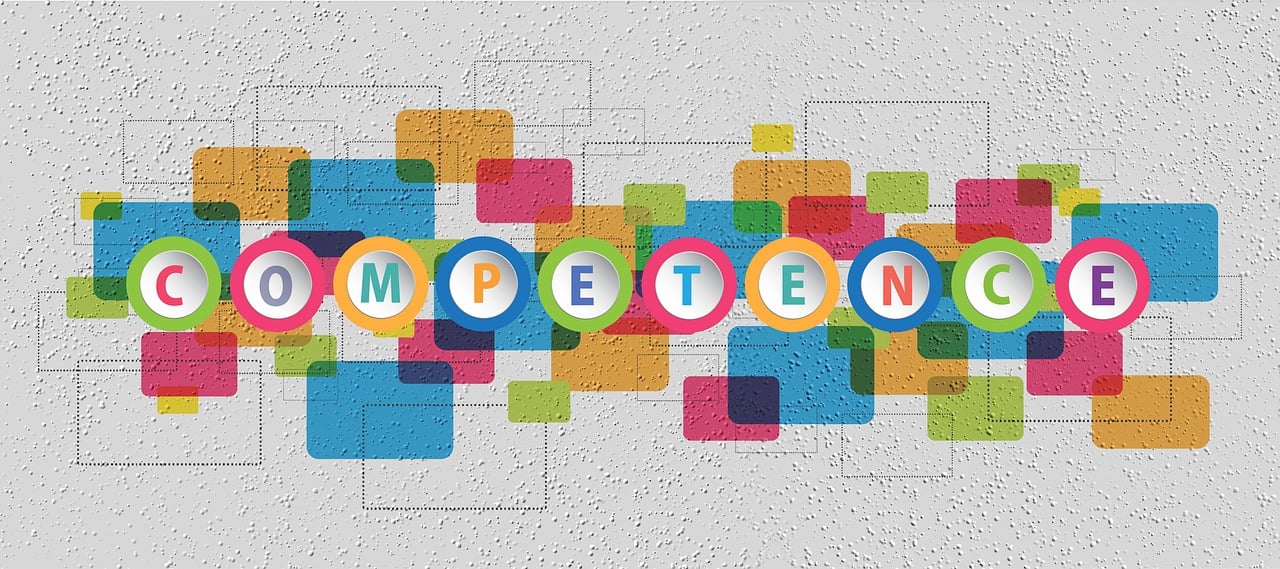


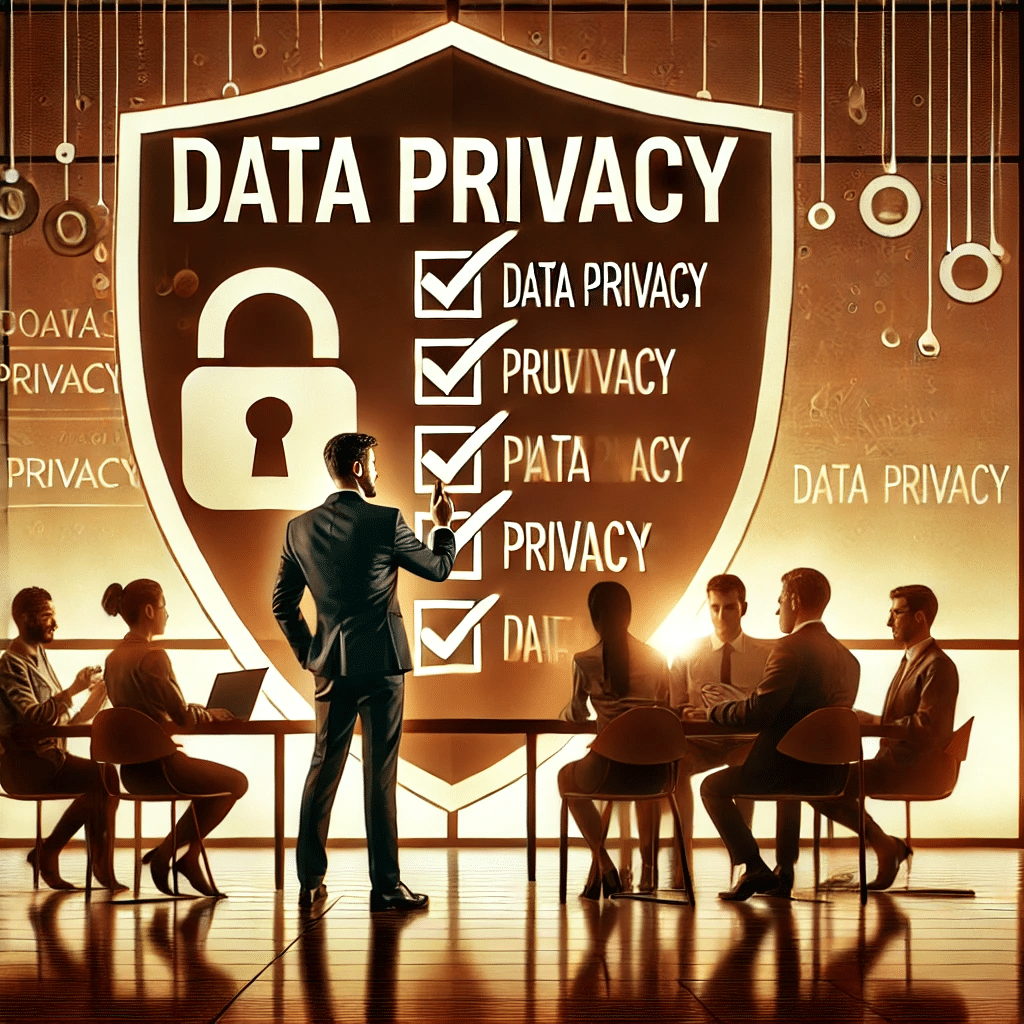












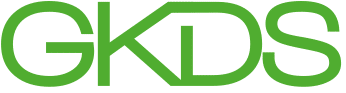

 Hahn IT Services, Schwaig
Hahn IT Services, Schwaig



