Das siebte ISB Boot Camp findet am 06.05. und 07.05.2025 in Gunzenhausen statt. Kommunale Informationssicherheitsbeauftragte und deren Stellvertretungen treffen sich zum fachlichen Austausch und zum Netzwerken. Ein breites Spektrum an Themen, dieses Jahr mit Fokus auf den weichen Faktoren und den organisatorischen Bereich, wird im Plenum und in den parallel an zwei Tagen stattfindenden Workshops geboten. Auch der Brückenschlag zwischen Informationssicherheit und Datenschutz steht auf dem Programm. Details und Link zur Anmeldung im Blogbeitrag.
Das "neue" Outlook für den Desktop von Microsoft (als Nachfolger der "klassischen" Version) zieht nicht nur die Zugangsdaten aller eingerichteten Mailkonten ab, sondern "spiegelt" die Inhalte in die Microsoft Cloud. Microsoft äußert sich dazu nur nebulös, was damit bezweckt werden soll. Datenschutz schlagen Alarm. Der Landesdatenschutzbeauftragte Thüringen warnte am 17.11.2023 in einer offiziellen Pressemeldung.
Die aktuelle ISMS-Fördermittelrichtlinie zur finanziellen Untersützung der Einführung eines Informationssicherheitsmanagementsystems im Sinne von Art. 43 BayDiG läuft zum 31.12.2023 aus. Wie Sie sich als bayersiche Kommune noch schnell Fördermittel für eine Umsetzung in 2024 / 2025 sichern, erfahren Sie im Blogbeitrag. Derzeit haben wir noch etwas Luft im zweiten Halbjahr, um Sie in gewohnter Umsetzungsqualität zu unterstützen. Dabei ist es egal, für welchen Standard Sie sich entscheiden: Arbeitshilfe, CISIS12, ISMS4KMO, BSI IT-Grundschutz (Kommunalprofil, Basis-Absicherung, Kern- oder Standardabsicherung) oder ISO 27001. Unser Team ist für alle Standards qualifiziert bzw. zertifiziert. Es heißt "schnell sein". Die Fördermittelstelle kann nach einem Antragseingang nach dem 15.11 2023 nicht mehr garantieren, ob es mit einer Förderzusage noch klappt.
Das BSI stellt vor: WiBA - Weg in die Basis-Absicherung. Wem als Kommune oder Firma das sog. "Kommunalprofil" oder die eigentliche Basis-Absicherung des IT-Grundschutzes noch als zu aufwändig erscheint, kann mittels WiBA erste Schritte in deren Richtung unternehmen. In 18 Kapiteln mit handverlesenen (und wenigen) Fragen zur Informationssicherheit kann der Status Quo des eigenen Sicherheitsniveaus grob identifiziert werden. Einen kontinuierlichen Betrieb eines Sicherheitskonzepts kann WiBA jedoch nicht leisten. Dazu sind die größeren Informationssicherheitsmanagementsysteme notwendig. Wie eben die BSI IT-Grundschutz Basis-Absicherung, ISO 27001, die sog. "Arbeitshilfe" der Innovationsstiftung Bayerische Kommune, ISIS12 / CISIS12 oder z.B. ISMS4KMO. Aber jeder Schritt hin zu mehr Informationssicherheit zählt. Von daher, well done, BSI. Mehr im Blogbeitrag.
Wir freuen uns, dass wir ab sofort bayerischen Kommunen den notwendigen Auditor bieten und das Fördermittelaudit Kommunalprofil und Basis-Absicherung des BSI IT-Grundschutz auf Basis eines belastbaren und nachvollziehbaren Prüfschemas durchführen können.
Dreh- und Angelpunkt des Artikel 32 DSGVO sind die technischen und organisatorischen Maßnahmen, auch kurz TOM genannt. Mittels einer geeigneten Auswahl und Anwendung dieser Schutzmaßnahmen (quasi eine Art Werkzeugkasten) sollen personenbezogene Daten vor den alltäglichen Risiken bei deren Verarbeitung (also Erhebung, Speicherung, Nutzung, aber auch beabsichtigter Löschung und Vernichtung) geschützt werden. Dabei soll nicht alles an Schutzmaßnahmen ergriffen werden, was irgendwie geht, sondern der Gesetzgeber spricht von einer Angemessenheit. Die Schutzmaßnahmen müssen also zum Schutzwert der betroffenen personenbezogenen Daten passen. Dabei sollen dann auch Faktoren wie die Eintrittswahrscheinlichkeit und das zu erwartende Schadensausmaß berücksichtigt werden. Das hier eigentlich nichts anderes als ein Informationssicherheitskonzept bzw. Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) gemeint ist, erklären wir im Blogbeitrag. Dazu stellen wir mögliche Standards vor, mit denen Sie die Anforderungen bestens erfüllen können. Allen voran - als Einstieg für große Organisationen und als ISMS für kleine Kommunen und Firmen bestens geeignet - die sog. "Arbeitshilfe".
Kennen Sie schon unser regelmäßiges Webinar "Einführung in die Grundlagen des Datenschutzes DSGVO" für neue Mitarbeiter und zur Auffrischung? Keine Zeit oder Gelegenheit, neue Mitarbeiter stets direkt nach der Anstellung mit diesem Thema vertraut zu machen? Liegt die letzte Datenschutz-Schulung für Ihre Mitarbeiter schon länger zurück? Dann ist unser üblicherweise monatlich stattfindendes Webinar genau das Richtige für Ihre Organisation. Auf humorvolle Art und Weise machen wir Ihre Mitarbeiter in 90 Minuten mit den Grundlagen vertraut. Wir wollen dabei keine Datenschutz-Profis ausbilden, sondern für das Thema generell sensibilisieren und den Grundstein für eine stets frühzeitige Einbindung des Datenschutzbeauftragten legen. Fragen dazu? Antworten im Beitrag. Wir freuen uns auf Sie!
Das BSI warnt aktuell vor einem möglichen Datenschutzverstoß bei Nutzung von VirusTotal. Neben dem Datenschutzrisiko sind aber auch andere schützenswerte Informationen der eigenen Organisation oder von Externen in Gefahr, Dritten gegenüber offengelegt zu werden.
Kostenfreie Webinare zur Umsetzung der Whistleblowing-Richtlinie / des Hinweisgeberschutzgesetz in Ihrer Organisation von Whistle Safe e.K.




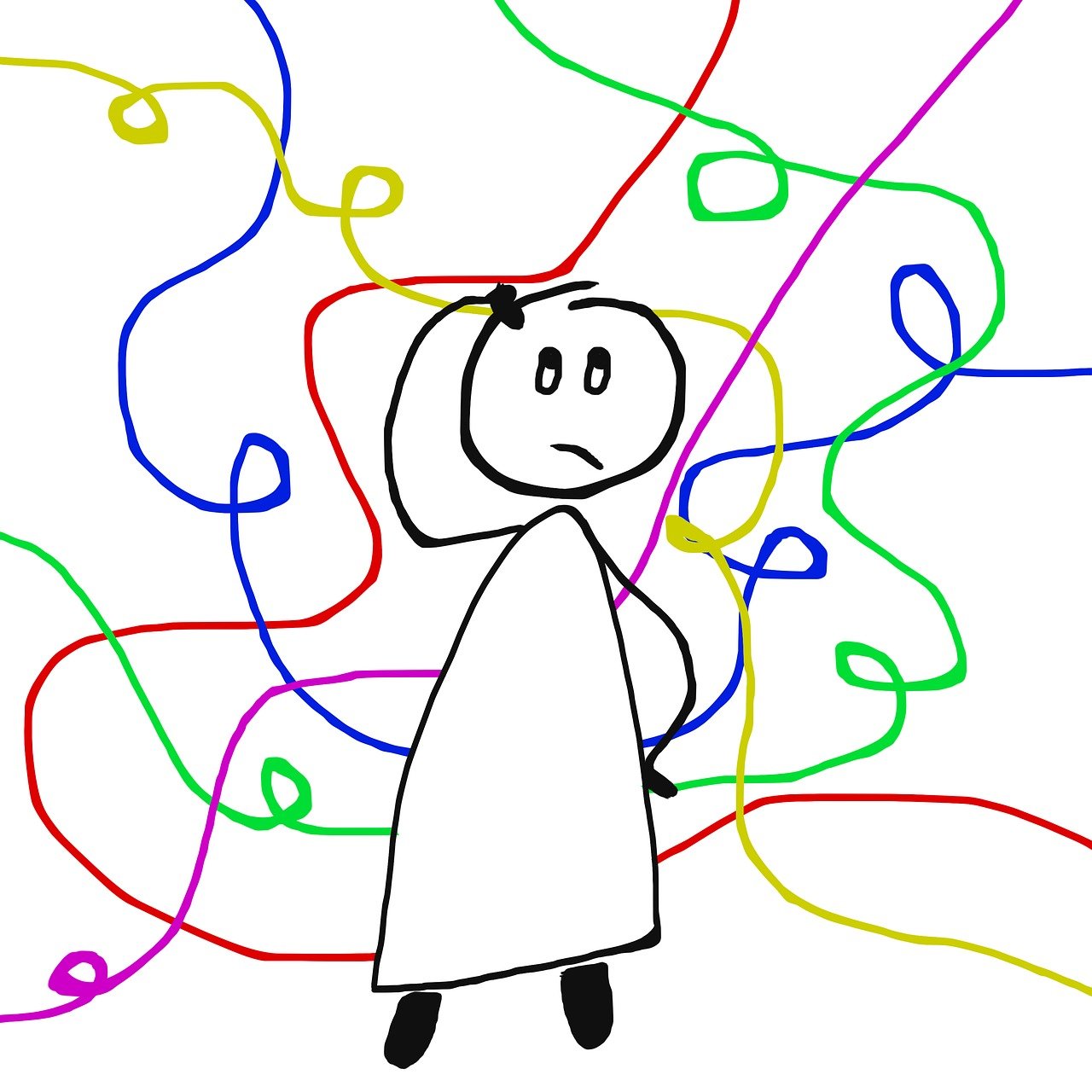

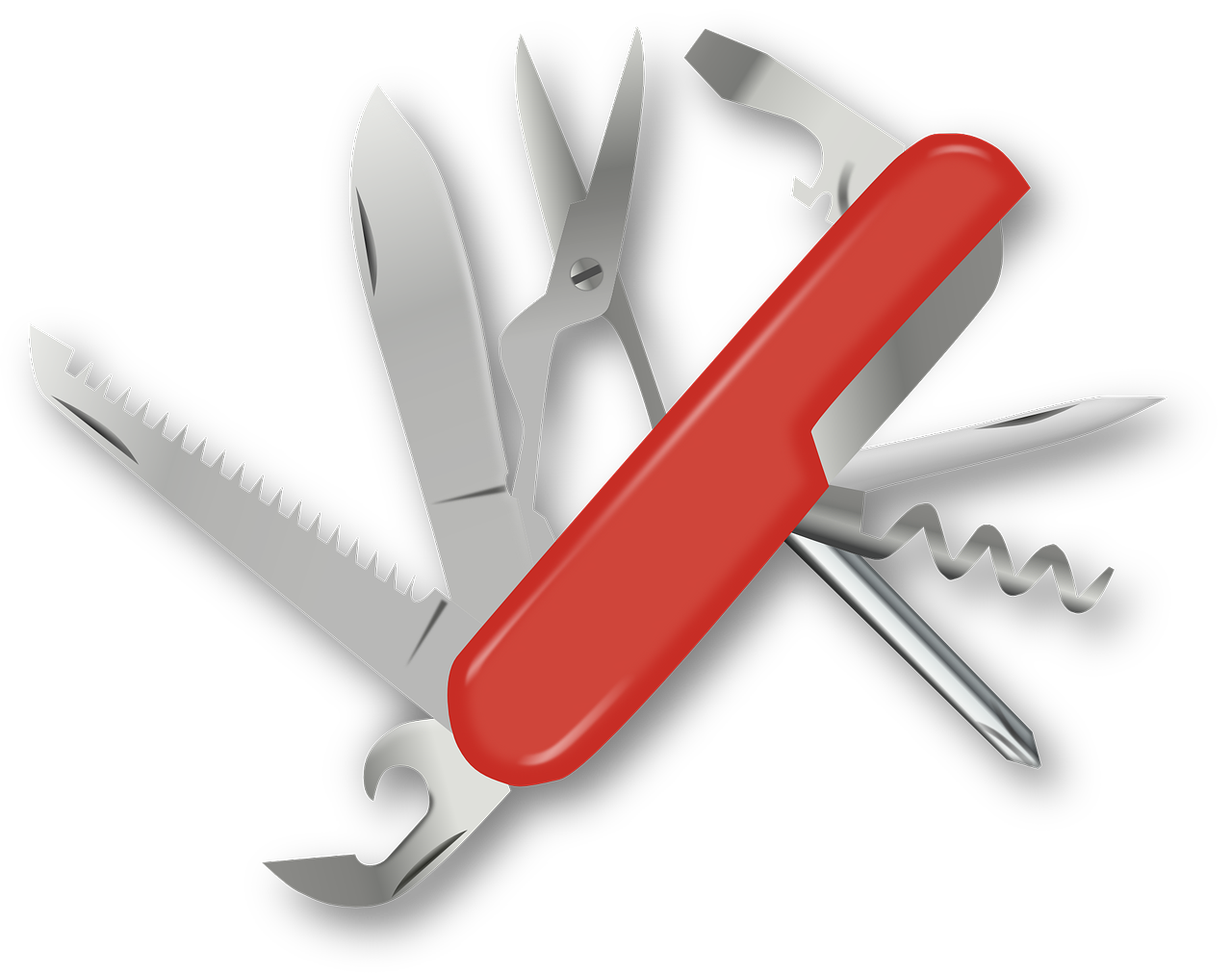












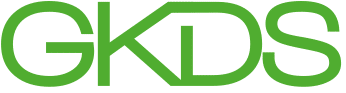

 Hahn IT Services, Schwaig
Hahn IT Services, Schwaig



